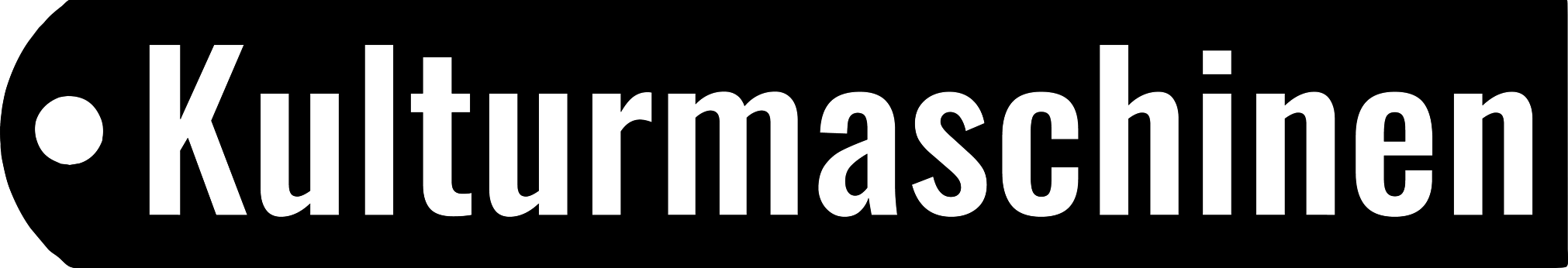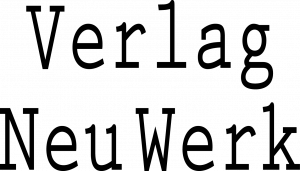Sie gehörte zu den Orten, an denen die Zeit vorbeigeht, die unverändert darauf warten, dass man sie im Sommer besucht, bewohnt und wieder verlässt bis zum nächsten Jahr. Elf Kilometer Strand, keine Autos, menschenleer abends, wenn das letzte Boot in die Stadt gefahren war, die Strandbars schlossen und nur die Bewohner des Zeltplatzes übrigblieben.
Viele portugiesische Familien und viele internationale Familien. Die meisten kamen immer wieder, wir versammelten uns um die Grillplätze, tranken Wein vor unseren Zelten, gingen schwimmen bei Meeresleuchten und übernachteten mit Lagerfeuer am Strand. Die Kinder spielten Fußball und Fangen in allen Sprachen. Die Eltern genossen die Freiheit, ganz ohne Babysitter. Der Sternenhimmel war großartig, wir sahen Mondfinsternisse und einen Blutmond und fühlten uns abgeschieden von der Welt, mitten im Algarve. Wenn die Wellen am Strand zu hoch waren, planschten die Kinder in der Lagune, sahen den Fähren zu, die von der Stadt kamen, fanden Muscheln und Einsiedlerkrebse. Mit dem Schiff gelangte man in wenigen Minuten in die Stadt und zum wunderbarsten Markt. Der wurde irgendwann aus der schönen alten Halle am Fähranleger in ein neues Gebäude umgesiedelt, aber die Marktleute blieben dieselben, sie erkannten uns wieder und beschwerten sich gelegentlich, dass meine Kinder kein Portugiesisch sprachen.
Auf dem Camping gab es keine Kühlschränke, der Fisch hing mariniert in den Bäumen und wurde von der Sonne vorgegart. Auch sonst hatte der Platz keinen überflüssigen Komfort zu bieten, es gab kalte Duschen und viel Sand, ein bisschen Schatten, sehr viele Mücken und hin und wieder Ratten. Am Zaun erschien nachts manchmal ein Fuchs, der es auf geheimnisvolle Weise auf die Insel geschafft hatte und ließ sich mit Essensresten füttern. Ebendieser Fuchs klaute uns nachts am Strand ein großes Stück Käse, ließ die Choriço aber liegen.
Am Wochenende reisten Jugendliche zum Feiern an, dann wurde am Strand getanzt, der Campingplatz wurde laut und voll, bis am Sonntagnachmittag die Inselruhe zurückkehrte.
Zwei meiner Kinder lernten schwimmen auf der Ilha. Wir blieben manchmal den ganzen langen Sommer – die Übernachtung kostete fast nichts. Oft gingen wir wandern oder Städte erkunden und kamen zum Ende unserer Ferien dorthin, wie man nach Hause kommt. Und trafen zuverlässig Bekannte und Freunde, ob man sich vorher verabredet hatte oder nicht.
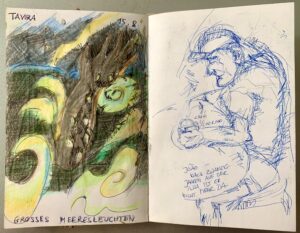
Im Herbst schloss der Campingplatz und öffnete erst im Mai wieder. Aber zwanzig Jahre lang hatte er das ganze Jahr über einen einsamen Bewohner, João. Klein, krumm und alt saß er ganz hinten bei seinem Zelt oder am Tisch in der Bar, trank café com cheirinho, Espresso mit Schnaps, und schien sich ebenso wenig zu verändern wie alles um ihn herum. Er stammte aus Lissabon, hatte die Stadt aber seit 25 Jahren nicht mehr betreten. Auch die Stadt Tavira besuchte er nicht gern, er ließ sich seine Lebensmittel von anderen Leuten mitbringen. Er badete nicht im Meer, nur in der Lagune, zu viele Leute, sagte er, habe er ertrinken sehen. Er war Ingenieur gewesen, nach einem Arbeitsunfall lebte er von einer kleinen Rente. Eines Sommers war er plötzlich nicht mehr da. In einem Pflegeheim, nach einem Schlaganfall. Das war vor sieben Jahren.
Diesen Sommer ist alles verschwunden. Den Campingplatz gibt es nicht mehr. Die Stadt hat ihn an einen Investor verkauft. Nächstes Jahr soll etwas Grauenvolles mit dem Namen „Eco Glamping“ dort eröffnet werden. Das Plakat am Bauzaun verspricht ein Resort, das halb von einem Römerlager bei Asterix, halb vom Club Méditerranée inspiriert scheint. Mit Rasenflächen und Pool und einer Art Aussichtsplattform, so dass man an den Strand nicht einmal mehr gehen muss. Die Familien, die bisher ihre Sommer auf der Ilha de Tavira verbracht haben, werden einen Aufenthalt dort nicht bezahlen können. Und wenn ich es bezahlen könnte, so würde ich an einem solchen Ort gewiss nicht sein wollen.
Christine Sterly-Paulsen