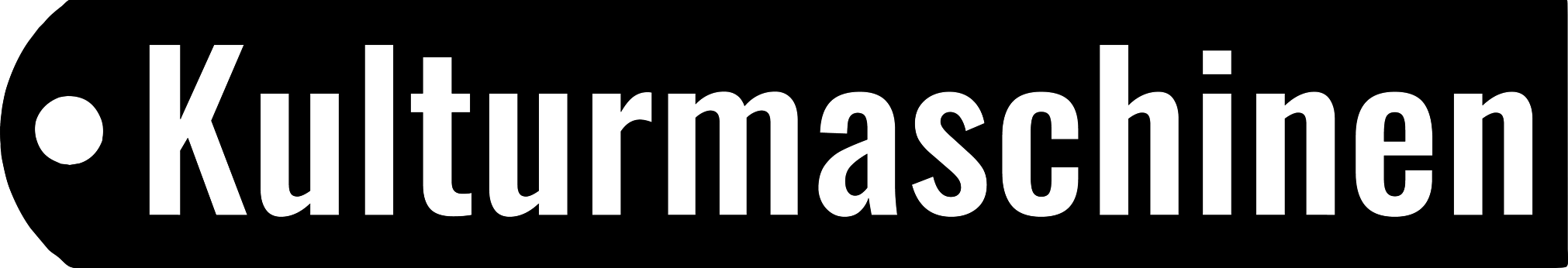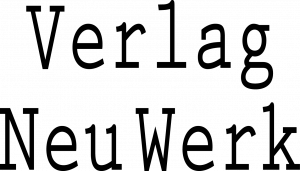Digital Detox – ein Selbstversuch
Vorbemerkung.
Der Wecker klingelt: Halb sieben. Benommen taste ich nach dem Handy neben meinem Bett und checke blinzelnd – noch halb im Traum – die Nachrichten in meinen Apps: Trump. Putin. Gaza. Klima. Krise. Und Krieg. Krieg. Krieg. Mein Herz stolpert. Tapfer scrolle ich weiter durch Wahnsinn, Horror, Unvernunft. Beginne ich über das Gelesene nachzudenken, möchte ich einfach nur unter meiner weichen Decke liegenbleiben und weiter träumen.
Als Kind dehnte sich die Zeit ins Unendliche. Heute pocht sie unerbittlich an die Tür und treibt mich voran. Nicht trödeln. Nicht innehalten. Bloß nichts verpassen. Mithilfe von Instagram (gefällt Steffi und weiteren Personen) bringe ich die notwendige Energie auf und schleppe mich ins Bad. Dort schalte ich auf meinem Handy das Deutschlandradio ein. Ich brauche mehr Informationen. Und während ich mir Shampoo aus den Haaren spüle und mit Zahnseide hantiere, verfolge ich Interviews, Meinungen und Fakten. Eine Stunde später nippe ich an meinem ersten Kaffee und bin bereits mental total erschöpft.
Scheint die Sonne? Regnet es? Haben wir Ostwind? Ich hab’s noch gar nicht mitgekriegt.
Freiwillig begebe ich mich jeden Morgen ins Netz und merke nicht, wie allmählich mein Gehirn verklebt und meine Gedanken sich im Kreise drehen. Früher konnte ich locker zwei bis drei Stunden am Stück ein Buch lesen. Heute schaffe ich maximal eine halbe Stunde und schau zwischendurch noch aufs Handy, um: a) nichts zu verpassen (was genau?), b) mich mal kurz abzulenken vom Buch / der Zeitschrift (what?), c) aus purer Gewohnheit und ja, irgendwie auch suchtgetrieben.
Diesen zunehmenden Mangel an Konzentration schob ich anfangs auf ein straffes Arbeitspensum am Rechner. Wer sechs bis acht Stunden Buchstaben vor der Nase hat wie ich, möchte abends nicht noch in Büchern blättern, so meine Erklärung. Ich fand, das klang plausibel. Aber es nervte mich. Erst nur ein bisschen. Dann massiv. Ebenso der stetig wachsende Bücherstapel neben meinem Bett. Ein Turm stillen Vorwurfs. Wie sollte das enden? Nur noch Hörbücher?
Auch mit der Arbeit an einem aktuellen Projekt tat ich mich schwer. Das Thema lag auf dem Tisch. Auch ein großer Teil des recherchierten Materials. Aber mein Kopf fühlte sich oft leer an. Oder zu voll. Ich kam nicht in den Flow. Mir fehlte der innere Raum. Ich drehte mich um mich selbst, war frustriert, zweifelte und flüchtete in Prokrastination (alle Hundedecken waschen, Terrasse schrubben, Kleiderschrank ausmisten für Oxfam).
Ich beschloss: Ab sofort fahre ich meine Mediennutzung runter. Erst mal nur eine Woche. Das schaffe ich locker, dachte ich zuversichtlich. Keine Apps, keine aktuellen Nachrichten, keine Podcasts, keine sozialen Medien. Okay waren Zeitungen, die ich in die Hand nehmen und wieder weglegen konnte, E-Mails (wegen der Arbeit), SMS-Korrespondenz mit Freunden und Musik. Und ich gestattete mir abends Folgen meiner aktuellen Lieblingsserie.
TAG 1
Heute Morgen schwebt mein Finger wie ferngesteuert über Instagram, ich kann ihn aber in letzter Sekunde schnell wegziehen. Ich glotze auf sämtliche Nachrichten-Apps, ohne sie zu berühren. Dahinter türmen sich Berge von vermeintlich relevanten Nachrichten auf, ohne die ich gefühlt kaum lebensfähig bin. Wie gern würde ich auf das weiße Kästchen rechts unten mit den Initialen „SZ“ tippen. Aber ich lasse es. Die Welt wird heute ohne mich untergehen. Auch die Radionachrichten verkneife ich mir. Stattdessen wähle ich klassische Musik: Die Cellosuiten von Bach. Sofort stellt sich ein Sonntagsgefühl ein, denn Sonntags gab es bei meiner Patentante zum Frühstück klassische Musik.
Im Laufe des Tages checke ich meine Mails und recherchiere im Netz. Abends beim Bügeln schaue ich eine Folge von „The Newsreader“. Zwei Folgen wären auch schön, denke ich, kann mich aber zum Glück beherrschen.
Mein Kopf fühlt sich deutlich luftiger an. Besondere Ideen: Keine. Ich vermute, das liegt am Wetter.
TAG 2
Wie in Trance lande ich noch vor dem Aufstehen auf einer Push-Up-Nachricht meines Handys: Es geht um den Antihelden in „Die Tribute von Panem“. Und schon lese ich begierig die ersten Zeilen. Bis mir siedend heiß einfällt: Genau das willst du doch gerade nicht mehr! Wieso habe ich überhaupt das Handy in der Hand? Wieso liegt es neben meinem Bett, wo ich doch detoxen will? Ich suche mir auf Spotify die „Brandenburgischen Konzerte“ raus. Die Klänge versetzen mich augenblicklich in mentale Tiefenentspannung. Im Laufe des Tages schafft es tatsächlich die ein oder andere Idee von meinem Kopf aufs Papier, und ich belohne mich mit sechs Minuten YouTube. Meine Ausrede: Ein Freund hat mir ein Video von einer Konzertaufzeichnung geschickt und die muss ich mir natürlich ansehen. Alles andere wäre unhöflich, rede ich mir ein.
Abends schaue ich eine weitere Folge von „The Newsreader“. Statt zu streamen, könnte ich eins meiner wartenden Bücher auf dem Stapel neben meinem Bett in die Hand nehmen, denke ich. Könnte. Hätte. Müsste. Laut einer Umfrage von 2025 (statistika.com) nutzen Menschen zwischen 30 und 49 Jahren ihr Smartphone im Schnitt 158 Minuten pro Tag.
Was könnte man in dieser Zeit alles tun? Den Hund und sich selbst mit einem üppigen Spaziergang beglücken. Einen Blogbeitrag schreiben. Für Freunde kochen. Anfangen, eine neue Sprache zu lernen. Die eigene Stadt erkunden. Oder auch einfach mal nichts tun. Jedenfalls komme ich bei drei Stunden Handynutzung pro Tag auf 630 Stunden im Monat. Reduziere ich meinen Konsum auf eine Stunde pro Tag, bleiben mir 420 Stunden im Monat zur Verfügung, in denen ich meiner Fantasie, Hilfsbereitschaft und Kreativität freien Lauf lassen kann.
TAG 3
Heute ist es richtig schwer, denn mein Spotify-Account ist morgens belegt (wir haben die sparsame Version, bei der immer nur eine Person konsumieren kann). Also keine Musik, und Stille aushalten. Wobei es ja nie komplett still ist. Irgendwo bei den Nachbarn dröhnt bereits früh morgens der Rasenmäher. Die elektrische Zahnbürste ist auch nicht geräuschlos. Der Kühlschrank piept, wenn er zu lange offensteht. Der Wasserkocher gurgelt. Öffne ich das Fenster, höre ich Vogelgezwitscher und die Müllabfuhr. Und halte ich mir die Ohren zu, höre ich mein Herz schlagen.
TAG 4
Nach dem morgendlichen Yoga – wieder Bach. Beim Frühstück: Stille. Das Rascheln der Zeitung. Zwitschernde und schreiende Vögel. Als ich meine Mails checke, lande ich plötzlich bei Annalena Baerbock und ihrem zukünftigen UN-Job. Außerdem catcht mich eine Mail der Süddeutschen Zeitung: ‚Die richtige Farbe wirkt wie gutes Make-up! – plopp lande ich in dem Artikel. Der mir im Übrigen nichts verrät, was ich nicht längst weiß. Dass mich Kükengelb blass macht und sattes Lila nur dunkelhaarigen Frauen steht. Eine Freundin, der ich von meinem neuen Detox-Projekt berichte, sagt ungerührt: „Ich höre nie Radio, und Podcasts machen mich nervös. Wie hast du das nur ausgehalten?“
Es ist eben so viel einfacher, sich beschallen, zudröhnen und ablenken zu lassen, als selbst etwas zu produzieren. Obwohl einen das, davon bin ich überzeugt, zufriedener und ja, auch glücklicher macht. Schreibe gerade nur mit der Hand. Da fällt das Bewerten und die ständige Selbstzensur weg, und die Gedanken gehen übers Herz direkt aufs Papier.
TAG 5
Heute Morgen: Entzugserscheinungen. Ich will noch vor dem Aufstehen sofort wissen, was wieder alles passiert ist. Also schnell aus dem Bett. Auch im Bad möchte ich dringend die Nachrichten hören. Mich auf Stand bringen. Stattdessen poltert nur die Waschmaschine. Und ich muss warten, bis ich eine Tageszeitung zwischen die Finger kriege. Ich fühle mich, als ob ich in einer Holzhütte leben würde, weit ab von jeglicher Zivilisation und ohne WLAN absolut nutzlos vor mich hinvegetiere.
Wie konnte ich existieren, als es das Internet noch nicht gab? Dafür ganze Altbauwände voller Billy-Regale und in den Regalen Bücher, die ich tatsächlich auch alle gelesen habe. Wie viel Zeit ich damals hatte.
Vor einem Jahr sind wir umgezogen. Da nimmt man alles einmal in die Hand und überlegt: behalten oder kann das weg. Bei den Kisten mit den Postkarten und Briefen kam ich ins Grübeln. Das sind ja in gewisser Weise Zeitdokumente. Kommunikationsschnipsel aus meinem früheren, analogen Leben. Die entsorgt man nicht einfach. Auch wenn das eine oder andere nicht unbedingt den eigenen Kindern in die Hände fallen sollte. Ich trenne mich von wenigen, immer gleichen Geburtstagsgrüßen.
Ich finde eine Postkarte, auf der steht: Ich hab heute bei dir geklingelt, aber du warst nicht da. In einem Brief vom März aus dem Jahr 1987 gibt es eine Einladung ins Theater für April desselben Jahres. Der Brief hat eine Briefmarke und ist abgestempelt. Wir schrieben uns Briefe, die drei bis vier Tage unterwegs waren (so jedenfalls meine Erinnerung; vielleicht ging es innerstädtisch auch schneller), und als Absenderin musste man Geduld haben. Ruft der andere an (schnell)? Oder schreibt er zurück (dauert)? Wir standen stundenlang in Telefonzellen oder kämpften mit ellenlangen Telefonkabeln, die die damalige Post (heute Telekom) mit einer Miete pro Meter Kabel (!) berechnete.
Was sonst noch an diesem Tag passiert: Ohne Podcast im Ohr mit dem Hund im Wald. Das hölzerne Klopfen zweier Spechte. Singvögel über mir in den Wipfeln. Die Schatten der Krähen am hellen Himmel. Wir laufen über eine Stunde. Ich bin beschwingt und atemlos fröhlich.
TAG 6
Heute stört es mich nicht, was gerade so los ist. So extrem viel wird sich in den letzten fünf Tagen nicht geändert haben. Die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. Spätestens übermorgen, wenn mein Versuch beendet ist und ich – so der Plan – ein ausgewähltes Zeitfenster für meine Nachrichten-Apps und Radiokonsum reserviere, werden mir die News über Trump & Co. wieder entgegenschwappen. Ich nehme mir vor: Maximal eine Stunde Kurznachrichten und Social Media am Tag. Instagram würde ich am liebsten löschen. Oder ich lösche die App auf dem Handy und stelle, falls ich doch mal drauf will, auf Schwarz-Weiß um. Das soll angeblich Anreize reduzieren.
TAG 7
Fast geschafft! Trotz meines Schreibpensums zwei dünne Bücher gelesen und heute morgen im Bad „The White Album“ von den Beatles angefangen. Dieses Album habe ich mir gekauft, als ich noch zur Schule ging, Lockenwickler benutzte und einen Plattenspieler hatte. Eine Kompaktanlage. Der Kauf des Albums war ein feierlicher Akt und ich bilde mir ein, noch zu wissen, wie es gerochen hat: Edel, besonders und ein bisschen nach CK One von Calvin Klein, das aber erst 1994 auf den Markt kam.
Seitdem habe ich zwar immer mal wieder einzelne Songs daraus gehört, aber nie das gesamte Album am Stück. Die Abfolge der Lieder kenne ich im Schlaf. Nach „I’m So Tired“ kommt „Blackbird“, gefolgt von „Piggies“ und „Rocky Racoon“.
Gegen jegliche Detox-Regel poste ich am späten Nachmittag einen Beitrag auf Instagram und rechtfertige das mit der Annahme, dass heute dafür die letzte Chance sei, weil an Wochenenden, noch dazu an sonnigen, die Leute was Besseres zu tun haben, als Beiträge zu liken. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich habe solche Lust auf diesen Post (das wunderbare Buch von Helene Bracht: „Das Lieben danach“), dass ich meine Vorsätze über den Haufen werfe nach dem Motto: Ist ja eh der letzte Tag! Als ich dann auf Instagram bin, verspüre ich wieder diesen Drang zu scrollen. Zeitgleich steigt Widerwillen in mir hoch. Ich beende zügig meinen Post und schließe Instagram. Tiefes Aufatmen. Doch eine halbe Stunde später bin ich schon wieder online, um zu sehen, wie viele Likes ich bereits für den Post erhalten habe.
Heute, gut drei Wochen später habe ich mein neues Digitalverhalten weitgehend beibehalten, mit mentalverträglichen Ausnahmen. Fahre ich in der Bahn, lese ich die Nachrichten in den Apps. Alle zwei bis drei Tage höre ich eine Sendung im Radio, die mich interessiert. Nach wie vor keine Podcasts. Morgens Stille, die ich genieße. Ich bin ausgeglichener und produktiver. Das ist mein neuer Weg.
Neulich im Theater saß eine Frau neben mir. Alle paar Minuten kontrollierte sie ihr Handy. Ein stetes Leuchten in der Dunkelheit. Es nervte. Ich sagte nichts und guckte nur. In der Pause verschwand sie und tauchte zum zweiten Teil der Vorstellung nicht mehr auf. Wahrscheinlich um wichtige Dinge auf ihrem Handy zu erledigen. Dinge, die keinen Aufschub dulden.
Ulrike Zeidler