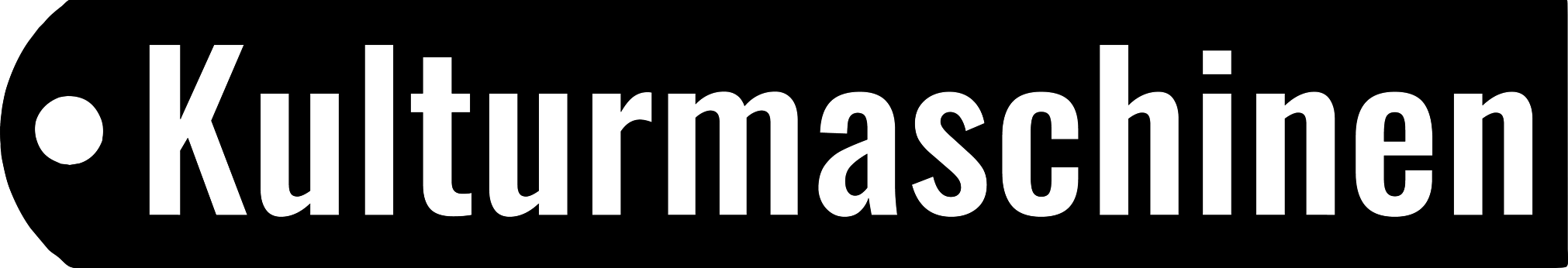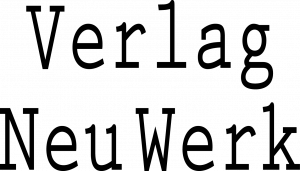2022 jährt sich die erste Weltumsegelung zum 500. Mal. Darüber schreibe ich seit langem einen Roman, der in den Kulturmaschinen erscheinen wird. Der Arbeitstitel lautet: “Mit Magellan”. Fünf Jahrhunderte sind weiß Gott eine lange Spanne, um nicht zu sagen ein Abgrund. Die Frage, ob der Autor sich überhaupt in diese Vergangenheit hineinversetzen kann, ist da berechtigt. Glücklicherweise sind Kapitäne geborene Logbuch- und Tagebuchschreiber, und auch sonst haben Zeitzeugen eine Menge hilfreicher Betrachtungen gemacht. Gerne möchte ich einen besonderen Dank an den Italiener Francesco Carlotti abstatten, der vom 20. Mai 1591 bis zum 12. Juli 1606 die Welt bereiste, all überall Handel trieb und sie in mehreren Etappen mit dem Segelschiff umrundete. Vom Atlantik in den Pazifik schlüpfte er allerdings nicht durch die Magellanstraße, sondern kämpfte sich am Isthmus von Panama über Dschungelpfade.
Der reisende Kaufmann Carlotti war ein harter Hund und zugleich ein höchst empfindsames Gemüt, das macht ihn zu einem unerschrockenen und hervorragenden Augenzeugen. Er handelte auf einem Teil seiner Weltreise mit Sklaven, die er von Westafrika in die Karibik verkaufte, und klagte sich selber dafür in beredter Form an, nicht ohne schlussendlich Gottes barmherzige Vergebung zu erbitten. Das verschlägt einem bei der Lektüre seines Reiseberichts den Atem. Gutes Schreiben entschuldigt nichts, und sollte er eine Fehlbitte an den Allerhöchsten getan haben und für sein grausames Geschäft in der Hölle schmoren, bin ich damit kommode. Andererseits hätte ich meinen Roman ohne Zeitzeugen wie den italienischen Sklavenhändler (der später lieber mit Seide, Diamanten und Porzellan aus China zu Markte ging) nicht in dieser hautnahen Weise zustande bringen können.

Empathie ist das große menschliche Vermögen. Manchen Menschen geht sie dennoch ab, wie anderen ein Bein, oft genug trifft das bei Schwerverbrechern zu. Der Signore Carlotti beweist, dass man sie als vorgeblich zivilisierter Mensch auch zeitweilig beiseiteschieben kann. Wie es ihm im Alter damit ging, ob er sich unter Umständen Phantomschmerzen oder eine posttraumatische Belastungsstörung eingefangen hatte, wissen wir nicht. Um über ihn hinauszugehen, ich bin der Meinung, dass sich empfindsame Naturen, die nicht gegen ihre Neigung handeln, wozu ich Autor*innen beiderlei Geschlechts zähle, in beinahe alle Menschen und Zustände einfühlen können, was per se nicht bedeutet, sie zu bejahen. Als Mann kann ich Frauenfiguren erfinden und zu literarischem Leben erwecken, als Weißer kann ich über Schwarze schreiben (und umgekehrt). Und dann ergibt sich das weite Feld der Rollenprosa. Insofern bin ich ein geschworener Gegner der Identitätspolitik und finde es gequirlte Kacke, wenn etwa nur Schwarze Gedichte von Schwarzen übersetzen dürfen (und nur Weiße demnächst solche von Weißen, aber bitteschön keinen Goethe vom Chinesen).
Klar ist aber auch, dass die Einfühlung Voraussetzungen und Grenzen hat. Um auf meinen Magellan-Roman zurückzukommen, da war ich in vielen Jahren der Arbeit am Text dankbar für alle freundlichen Denk- und Formulierungshilfen tüchtiger Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts. Manche Bemerkung habe ich wörtlich benutzt, andere umformuliert, wo ich der Ansicht war, dass heutige Leserinnen sie im Original nicht verstehen würden. Denn neben der Authentizität sind das Vergnügen und die – relative – Bequemlichkeit des Lesers für mich bedeutsam. Auch da arbeite ich mit dem Einfühlungsvermögen, ich weiß es von mir selber als Leser, dass ich eine gewisse Anstrengung in der Lektüre geradezu genieße; aber dauernd bei Google und Wikipedia nachschlagen möchte ich nicht. So habe ich in meinem Werk etwa den Lazarus Archipel an wenigen Stellen auch Philippinen genannt, um dem Leser auf die Sprünge zu helfen, und nehme damit in aller Demut des Romanciers Hohn und Spott der historischen Zunft und aller Pedanten dieser Welt in Kauf, denn die Philippinen als geografischen Begriff gab es zu Magellans Zeiten noch nicht, schließlich regierte Kaiser Karl V. und nicht König Philpp in Spanien.
Rund achtzig Jahre trennen Don Fernando und den Signore Carlotti bei ihren Weltreisen. Einerseits staunt der Leser, welche grundstürzenden Entwicklungen sich in der Spanne bloß eines längeren Menschenlebens in Ultra Mar, auf den Weltmeeren, ergeben haben. Die Philippinen sind erobert, Manila ist die Hauptstadt der spanischen Kolonie, es findet ein regelmäßiger Handel mit Waren aus China und Japan statt, und zwar auf Karavellen, die von Manila aus ihre Reise gen Osten über den Pazifik an die Westküste des Vize-Königreichs Mexiko antreten (und von der Ostküste Mexikos weiter nach Spanien). Holländer und Engländer, die den iberischen Völkern ihre lukrativen Eroberungen und den Handel streitig machen, sind mittlerweile auf allen Meeren unterwegs.
Jenseits dieser Entwicklungen hat sich aber nicht viel geändert, und Francesco Carlotti bleibt ein Mann des ganzen 16. Jahrhunderts, eingebettet in zählebige mittelmeerische Denktraditionen und Gepflogenheiten. Niemals wäre ich ohne seine Hilfe darauf gekommen, der Beschreibung einer besonders elastischen und haltbaren Faser der Philippinen den Nachsatz hinzuzufügen, es müsste bei Strafe der Exkommunikation verboten werden, damit Sklaven zu schlagen. (Mit minderwertigerem Tauwerk muss der weiße Christ leider schon mal peitschen.)
Bei aller Weltläufigkeit des Schiffsverkehrs darf man nicht übersehen, dass es in jedem Jahr nur ein paar Handvoll Karavellen und Gallionen sind, die abendländische Handelsmacht aufspannen. Sitten und Gebräuche der Völker jenseits von Gibraltar wie auch die unzähligen Tiere und Früchte der Tropen bleiben in Europa weithin unbekannt. Mein Bestreben war es, diese Gegebenheiten mit Worten und Vergleichen der Zeitgenossen zu beschreiben, und da habe ich dankbar gewildert, Piraterie betrieben und abgekupfert.
Wenn Pigafetta, der Vater aller Reisebücher, die Ananas als eine Art großen Tannenzapfen beschreibt, so wäre ich durch glückliches Nachdenken vielleicht auch auf diesen Vergleich gekommen, dennoch wäre der stachlige Zweifel geblieben, ob ich mir nur etwas zurecht spintisiert hätte. Viel grüblerischen Schweiß hat mir die Beschreibung der Banane durch Pigafetta und Carlotti als Sichelfeige bereitet. Irgendwann, und es hat gedauert, habe ich dann verstanden, dass der Vergleich in erster Linie darauf abzielt, wie der Frucht mit der Hand die Schale abgezogen wird, bevor man das Fruchtfleisch isst. Die Sichelfeige finde ich nach wie vor schräge, umso dankbarer bin ich meinen Gewährsleuten für ihre authentischen Informationen. Und dergestalt habe ich mich Stück um Sprachstück vorgearbeitet, habe mühsam herausgefunden, wie die Schiffskinder auf Seereisen ihr großes Geschäft erledigten, sie gingen in den Garten. Ach so, wie der aussah? Der Leser erfährt es.
In beinahe allen Seefahrtsbüchern, die ich gelesen habe, war es dagegen so, dass die Besatzungen nie nicht ein großes Geschäft bedrängte, ebenso wenig wie in früheren Western die Revolverhelden nachladen mussten. Ich wollte davon nichts wissen, sondern Menschen mit allen Stärken und Schwächen zeigen. Manchmal reden sie dummes Zeug, manchmal sind sie überaus clever, sobald der heutige beschränkte Mensch nur begreift, worum es hinter dem Nebel der Worte wirklich geht, manchmal reden und tun sie empörende Dinge. Um mit der Empathie zu enden: Im Laufe des Schreibens habe ich meine Brust erweitert und sie alle in mein Herz geschlossen. Das tut durchaus oftmals weh, da ist ein Preis zu zahlen, wenn man einen Roman schreibt.
Carlotti und sein Reisebuch eines Sklavenhändlers stammen aus dem fernen Italien, doch wie steht es bei uns? In meiner Nachbarschaft in Hamburg-Wandsbek steht ein Mausoleum des Kaufmanns und Sklavenbarons Heinrich Carl von Schimmelmann, der seinen großen Reichtum ebenfalls dem Menschenhandel und dem mit Sklavenarbeit produzierten Rum verdankt. Hamburg hat eine ungute Tradition, hanseatisch zurückhaltend über die Schattenseiten seiner Geschichte hinwegzusehen. Niemand in der Handelsstadt der Pfeffersäcke hat bislang an der protzigen Arroganz der Schimmelmann’schen Grablege Anstoß genommen. Um das Maß der Peinlichkeit voll zu machen, liegt gleich in der Nachbarschaft die Ruhestätte von Matthias Claudius, der unser aller Wiegenlied gedichtet hat: Der Mond ist aufgegangen …
Ja, so ist Hamburg, wenn man es lässt. Der Horror wird als gemütlich verkauft. Man schlägt aus Himmel und Hölle gleichermaßen Profit. Und sonntags geht man bei Orgelmusik in den Michel. Gruß an einen Sklavenhändler. Längst ist es an der Zeit, dem sichtbaren Zeichen des grausam erworbenen Schimmelmann’schen Reichtums eine Erinnerung an seine schwarzen Opfer zur Seite zu stellen. Lieber Gott, empört euch gefälligst, ihr Leute der Stadt, das dürfte doch nicht so schwer fallen.